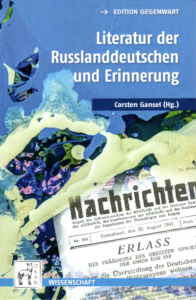Autorenlesung und Diskussion – emotional und persönlich, konstruktiv und von Verständnis geprägt
von Nina Paulsen
 „Meine Mitschüler, meine Kommilitonen und Mark waren erzogen worden, ihr Glück vom Leben einzufordern; ich war in Deutschland dazu erzogen worden, nicht aufzufallen und niemanden zu stören“, sagt der Ich-Erzähler im Viktor Funks Buch „Mein Leben in Deutschland begann mit einem Stück Bienenstich“ (Größenwahn Verlag Frankfurt/Main 2017). Eine Beschreibung, die auf die zerrissene Mentalität vieler Russlanddeutscher auf ihrer Suche nach Identität und Beheimatung genau zutrifft – in ihrer neuen Heimat Deutschland nicht anders als zuvor in der Sowjetunion. Am 22. November 2018 las der Autor auf Einladung des Nürnberger Kulturbeirats zugewanderter Deutscher, der die kulturellen Belange der deutschen Aussiedler und Vertriebenen in Nürnberg vertritt, im Zeitungs-Cafe Hermann Kesten in Nürnberg aus seinem Debütroman. Die Lesung mit dem Frankfurter Autor und Journalisten wurde in Kooperation mit dem Bildungscampus Nürnberg veranstaltet.
„Meine Mitschüler, meine Kommilitonen und Mark waren erzogen worden, ihr Glück vom Leben einzufordern; ich war in Deutschland dazu erzogen worden, nicht aufzufallen und niemanden zu stören“, sagt der Ich-Erzähler im Viktor Funks Buch „Mein Leben in Deutschland begann mit einem Stück Bienenstich“ (Größenwahn Verlag Frankfurt/Main 2017). Eine Beschreibung, die auf die zerrissene Mentalität vieler Russlanddeutscher auf ihrer Suche nach Identität und Beheimatung genau zutrifft – in ihrer neuen Heimat Deutschland nicht anders als zuvor in der Sowjetunion. Am 22. November 2018 las der Autor auf Einladung des Nürnberger Kulturbeirats zugewanderter Deutscher, der die kulturellen Belange der deutschen Aussiedler und Vertriebenen in Nürnberg vertritt, im Zeitungs-Cafe Hermann Kesten in Nürnberg aus seinem Debütroman. Die Lesung mit dem Frankfurter Autor und Journalisten wurde in Kooperation mit dem Bildungscampus Nürnberg veranstaltet.
Moderiert wurde der Abend von Katharina Sperber, freiberufliche Autorin, Moderatorin und Kommunikationsberaterin aus Frankfurt, die das Entstehen des Buches begleitet hat und mit Viktor Funk mehrfach auf Lesungen gewesen ist – unter anderem bei den jüngsten Buchmessen in Frankfurt/Main und Leipzig. Die Veranstalter freuten sich über neue Gäste aus der Stadt und Umgebung – nicht zuletzt hatte zusätzlich zur Ankündigung des Kulturbeirats auch die kurze Buchbesprechung von Ella Schindler im „Stadtanzeiger“, die selbst Russlanddeutsche aus der Ukraine und seit Jahren Redakteurin der „Nürnberger Zeitung“ ist, Interessierte in das Zeitungs-Cafe gelockt.
Die Versammelten wurden von Dagmar Seck (Projektleiterin des Kulturbeirats zugewanderter Deutscher) und Susanne Schneehorst (Stadtbibliothek Nürnberg) begrüßt. Als sie in der Frankfurter Rundschau auf den Titel des Buches von Viktor Funk gestoßen sei, habe sie sich gefragt, „was das für Leute sind, deren Leben in Deutschland mit einem Stück Bienenstich beginnt“, bemerkte Schneehorst unter anderem.
 Als Viktor Funks Debütroman im vorigen Jahr erschien, nahm die Debatte über Integration und Heimat in Deutschland gerade Fahrt auf. Da der Autor zur zweiten Generation der (Spät-)Aussiedler gehöre, zu denen, die als Kinder nach Deutschland kamen, stelle sein Buch in gewisser Weise eine neue Perspektive dar, erläuterte die Moderatorin Katharina Sperber. Beide lasen abwechselnd aus dem Buch vor, kamen miteinander ins Gespräch und zogen auch die Zuhörer in die Diskussion ein. „„Mein Leben in Deutschland begann mit einem Stück Bienenstich““ weiterlesen
Als Viktor Funks Debütroman im vorigen Jahr erschien, nahm die Debatte über Integration und Heimat in Deutschland gerade Fahrt auf. Da der Autor zur zweiten Generation der (Spät-)Aussiedler gehöre, zu denen, die als Kinder nach Deutschland kamen, stelle sein Buch in gewisser Weise eine neue Perspektive dar, erläuterte die Moderatorin Katharina Sperber. Beide lasen abwechselnd aus dem Buch vor, kamen miteinander ins Gespräch und zogen auch die Zuhörer in die Diskussion ein. „„Mein Leben in Deutschland begann mit einem Stück Bienenstich““ weiterlesen