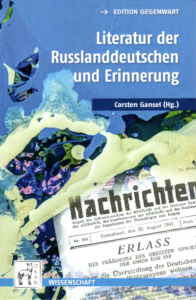„Heimat kann überall sein. Wir entscheiden mit unserem Herzen, wo diese ist.“
Eine Rezension von Nina Paulsen
Das Zitat ist die zehnte Lektion aus der Geschichte „Zehn Lektionen der Integration“, mit der Katharina Martin-Virolainen ihr Buch „Im letzten Atemzug“ abschließt, das kurz vor der Leipziger Buchmesse 2019 im OSTBOOKS Verlag erschienen ist. Dass diese Erkenntnis, wie viele andere auch, verschlungene Wege hatte – davon handelt das Erstlingswerk der jungen Autorin und zweifachen Mutter aus Eppingen. Das Buch ist eine Sammlung von meist autobiografisch angehauchten Kurzgeschichten aus den Jahren 2015 bis 2018, die sich in ihrer Gesamtheit mit der tragischen Geschichte und der komplexen Identitätsfindung der Russlanddeutschen beschäftigen.
 Schreiben und „Geschichten erzählen“ ist eine der Leidenschaften von Katharina Martin-Virolainen. In den letzten Jahren hat sie journalistische und literarische Beiträge auf Deutsch und Russisch in diversen Zeitungen und Zeitschriften veröffentlicht. „Ich schreibe gerne über geschichtliche, kulturelle, politische und gesellschaftliche Themen. Mir macht es Spaß, meine Gedanken kreativ im Schreiben zu verarbeiten, durch meine Beiträge Menschen zum Nachdenken, vielleicht sogar Umdenken, anzuregen, auch manchmal ein wenig zu provozieren und dadurch Diskussionen auszulösen“, sagt sie. Ihre Kurzerzählung „Und wenn die ersten Schneeflocken auf unser Land fallen“, in der sie die Erinnerungen an die Kindheit reflektiert, landete auf Platz 3 des bekannten bundesweiten Literaturwettbewerbs, der vom Bonner Institut für Migrationsforschung und Interkulturelles Lernen im Jahr 2017 veranstaltet wurde. Sie ist in einem Sammelband des Instituts bereits einmal erschienen.
Schreiben und „Geschichten erzählen“ ist eine der Leidenschaften von Katharina Martin-Virolainen. In den letzten Jahren hat sie journalistische und literarische Beiträge auf Deutsch und Russisch in diversen Zeitungen und Zeitschriften veröffentlicht. „Ich schreibe gerne über geschichtliche, kulturelle, politische und gesellschaftliche Themen. Mir macht es Spaß, meine Gedanken kreativ im Schreiben zu verarbeiten, durch meine Beiträge Menschen zum Nachdenken, vielleicht sogar Umdenken, anzuregen, auch manchmal ein wenig zu provozieren und dadurch Diskussionen auszulösen“, sagt sie. Ihre Kurzerzählung „Und wenn die ersten Schneeflocken auf unser Land fallen“, in der sie die Erinnerungen an die Kindheit reflektiert, landete auf Platz 3 des bekannten bundesweiten Literaturwettbewerbs, der vom Bonner Institut für Migrationsforschung und Interkulturelles Lernen im Jahr 2017 veranstaltet wurde. Sie ist in einem Sammelband des Instituts bereits einmal erschienen.
Als Autorin hat Katharina inzwischen einen festen Platz im Literaturkreis der Deutschen aus Russland e.V. gefunden. Sie nahm mehrfach an Lesungen teil und hat die Zuhörer zum Weinen und Lachen mit ihren Erzählungen gebracht, in denen sie ihre Erlebnisse in Kasachstan, Karelien und Deutschland verarbeitet hat. Mit Erkenntnis- und Gefühlsbeschreibungen, die in ihren Geschichten zum Ausdruck kommen, spricht sie vielen Landsleuten ihrer Generation, aber ebenso älteren Russlanddeutschen, aus der Seele. „Eine Frau hatte Tränen in den Augen, als sie auf meine Geschichte über meine Kindheitserinnerungen an Kasachstan einging. Sie sagte: Das ist genau das, was ich auch fühle ...“, erinnert sich Katharina an eine Lesung.
So will sie auch mit ihrem Buch und den Geschichten (zwei davon aus dem Russischen ins Deutsche von Carola Jürchott und Wendelin Mangold übersetzt) den unzähligen russlanddeutschen Schicksalen eine Stimme geben. Schon der erste Blick bleibt am Buchcover mit dem einprägsamen Bild des russlanddeutschen Künstlers Nikolaus Rode „Frauen und Kinder in Sibirien“ hängen. Das Werk von Nikolaus Rode (geb. 1940) ist ebenfalls untrennbar verknüpft mit seiner Lebensgeschichte, die von Krieg, Flucht, Deportation, Diskriminierung und dem Leid, den diese mit sich ziehen, gezeichnet ist.
 Die tiefere Bedeutung des Motivs und seine Verbindung zum Buch erschließt sich in der Geschichte „Im letzten Atemzug“, die dem Buch den Namen gibt, die Vergangenheit mit der Gegenwart verbindet und „In Erinnerung an Elisabeth und Hans Thiessen. Damit Eure Namen nicht vergessen werden“ entstanden ist. Das Schicksal von Liesel (Elisabeth) Thiessen, einst beschrieben im Roman „Alles kann ein Herz ertragen“ von Charlotte Hofmann-Hege, hatte Katharina ungemein berührt und sie lange Zeit danach beschäftigt. Es sorgte gleich für eine Wende in ihrem Denken und Handeln und war der Auslöser für die Titelgeschichte – beschreibt die Autorin in dem Nachtrag „Zur Entstehung von ‚Im letzten Atemzug‘ oder Wie alles begann“. „„Im letzten Atemzug“ – das erste Buch von Katharina Martin-Virolainen ist erschienen“ weiterlesen
Die tiefere Bedeutung des Motivs und seine Verbindung zum Buch erschließt sich in der Geschichte „Im letzten Atemzug“, die dem Buch den Namen gibt, die Vergangenheit mit der Gegenwart verbindet und „In Erinnerung an Elisabeth und Hans Thiessen. Damit Eure Namen nicht vergessen werden“ entstanden ist. Das Schicksal von Liesel (Elisabeth) Thiessen, einst beschrieben im Roman „Alles kann ein Herz ertragen“ von Charlotte Hofmann-Hege, hatte Katharina ungemein berührt und sie lange Zeit danach beschäftigt. Es sorgte gleich für eine Wende in ihrem Denken und Handeln und war der Auslöser für die Titelgeschichte – beschreibt die Autorin in dem Nachtrag „Zur Entstehung von ‚Im letzten Atemzug‘ oder Wie alles begann“. „„Im letzten Atemzug“ – das erste Buch von Katharina Martin-Virolainen ist erschienen“ weiterlesen