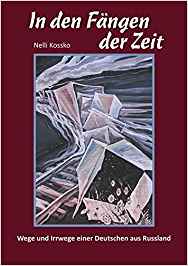Achtung! Seien Sie bloß vorsichtig, hier ist es gefährlich! Lesen Sie diese Gedichte auf keinen Fall – wenn Sie lieber beim Vertrauten bleiben, wenn keiner Ihre wohlgefügten Kreise stören soll, wenn Sie sich nicht herausfordern lassen möchten. Denn der da schreibt, der ist frech … und fromm.
Achtung! Seien Sie bloß vorsichtig, hier ist es gefährlich! Lesen Sie diese Gedichte auf keinen Fall – wenn Sie lieber beim Vertrauten bleiben, wenn keiner Ihre wohlgefügten Kreise stören soll, wenn Sie sich nicht herausfordern lassen möchten. Denn der da schreibt, der ist frech … und fromm.
Das ist das Beeindruckende an den Gedichten von Andreas Andrej Peters: Sie gehen virtuos mit der christlichen Tradition und dem biblischen Wort um, sie treten unverstellt in Beziehung und stellen in Frage („Ich trete ihm auf die Füße“), sie verlangen von Wort und Tradition, dass sie sich als heute gültig erweisen („DIE BIBEL//querlesen mit einem/balken vorm/gesicht“) und neu zu uns Heutigen sprechen. Fromm aber, im Sinne der tieftiefen Frömmigkeit etwa eines Gerhard Tersteegen („Gott ist gegenwärtig …/Gott ist in der Mitte …/Ich in dir,/du in mir …“), wie ein Mystiker – da mag die russisch-orthodoxe Tradition, die hier und da anklingt, wirksam sein – setzt Andreas Andrej Peters zugleich, dass Gottes Wort wirkt und geheimnisvoll waltet.
Es ist faszinierend zu lesen und (Empfehlung: Lesen Sie sich die Gedichte vor!) zu hören, wie diese poetischen Texte in Bewegung sind, wie sie tanzen und spielen – zwischen Frage und Antwort, zwischen Zweifel und Zustimmung, Klage und Trost.
Etwa in diesen Zeilen:
„Neuer Lyrikband „Rum & Ähre“ von Andreas A. Peters erschienen“ weiterlesen