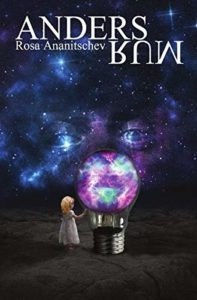„Es ist ein Text, der zum kulturellen Gedächtnis gehört, und dies stark zu machen, das scheint mir wichtig. Unabhängig davon halte ich es für eine grundsätzliche Aufgabe von Literaturwissenschaft, das Gedächtnis zu bewahren und sich auch nicht von Gegenstimmen, die es hier wie da gibt, abhalten zu lassen“, sagt der Literaturwissenschaftler und Herausgeber, Prof. Dr. Carsten Gansel, über den Roman „Wir selbst“ von Gerhard Sawatzky (1901-1944), der Anfang März 2020 im Verlag Galiani Berlin erscheint.
 Gerhard Sawatzky, in der Südukraine geboren, verbrachte seine Kindheit in Westsibirien und studierte am Leningrader Pädagogischen Herzen-Institut. Danach arbeitete er zuerst als Lehrer, dann als Journalist und Autor im Wolgagebiet, wo er als wichtigster Literat der jüngeren Generation der Wolgadeutschen und Vorkämpfer einer eigenständigen „sowjetdeutschen“ Literatur galt. 1937 vollendete er seinen Roman „Wir selbst“. Noch bevor der Roman, der bereits in Druckvorbereitung war, das Licht der Welt erblickte, wurde Sawatzky Ende 1938 verhaftet und starb Jahre später (1944) im GULag Solikamsk. Das Buch ist nie erschienen. Doch Sawatzkys Witwe Sophie Sawatzky gelang es, bei der Deportation nach Sibirien unter dramatischen Umständen das Urmanuskript zu retten.
Gerhard Sawatzky, in der Südukraine geboren, verbrachte seine Kindheit in Westsibirien und studierte am Leningrader Pädagogischen Herzen-Institut. Danach arbeitete er zuerst als Lehrer, dann als Journalist und Autor im Wolgagebiet, wo er als wichtigster Literat der jüngeren Generation der Wolgadeutschen und Vorkämpfer einer eigenständigen „sowjetdeutschen“ Literatur galt. 1937 vollendete er seinen Roman „Wir selbst“. Noch bevor der Roman, der bereits in Druckvorbereitung war, das Licht der Welt erblickte, wurde Sawatzky Ende 1938 verhaftet und starb Jahre später (1944) im GULag Solikamsk. Das Buch ist nie erschienen. Doch Sawatzkys Witwe Sophie Sawatzky gelang es, bei der Deportation nach Sibirien unter dramatischen Umständen das Urmanuskript zu retten.
„Wir selbst“ erzählt von einer untergegangenen Welt, nämlich der Autonomen Sozialistischen Sowjetrepublik der Wolgadeutschen (1918-1941). Im häufigen Szenenwechsel zwischen Land und Stadt beschreibt der Roman die entscheidende Wende im Leben der Wolgadeutschen von 1920 bis 1937: Die Auswirkungen der Oktoberrevolution 1917, den Bürgerkrieg, die Etablierung der Sowjetmacht, den offenen und getarnten Klassenkampf, die Kollektivierung und Industrialisierung.
Sawatzkys großer Gesellschaftsroman, der zu Lebzeiten des Autors nie erschienen war und erst 1984-1988 im Almanach „Heimatliche Weiten“ (hrsg. von Hugo Wormsbecher, Moskau – leider bearbeitet und zensiert) veröffentlicht werden konnte, ist das „bedeutendste Werk der sowjetdeutschen Vorkriegsliteratur“ (laut Woldemar Ekkert), das mit dem Leben der Wolgadeutschen in der Zwischenkriegszeit ein untergegangenes Stück Zeitgeschichte darstellt.
„Auch wenn Sawatzky schon beim Schreiben die Angst vor stalinistischen Säuberungsaktionen im Nacken saß und er manches unterschlug bzw. beschönigte – sein Buch ist ein höchst bedeutendes Zeitzeugnis“, ist in der Verlagsvorschau zum Buch nachzulesen. Der Herausgeber Carsten Gansel (geb. 1955, Professor für Neuere Deutsche Literatur und Mediendidaktik in Gießen) hat die einzigartige Edition mit einem aufschlussreichen Nachwort und dokumentarischem Material zur Wolgadeutschen Autonomen Republik und ihrer Literatur versehen. „Roman von Gerhard Sawatzky „Wir selbst“ erscheint erstmals in Buchform“ weiterlesen