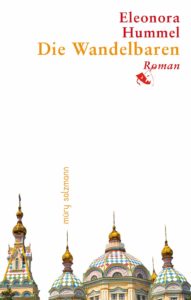Die Dichterin Nora Pfeffer gehört mit ihrer poetischen und schriftstellerischen Leistung zu den wichtigsten russlanddeutschen Autoren der Nachkriegszeit. Jahrzehntelang hat sie die Entwicklung der deutschen Literatur in der ehemaligen Sowjetunion mitgeprägt – als Lyrikerin, Übersetzerin, Nachdichterin, Essayistin und Literaturkritikerin. Pfeffers Werke sind in ca. 15 Einzelbänden erschienen, darunter mehrere Versbücher für Kinder, Lyriksammlungen und Bücher mit Nachdichtungen.
Sie wurde am 31. Dezember 1919 in Tbilissi/Georgien in einer Lehrerfamilie geboren. Noras Kindheit endete 1935 abrupt mit der Verhaftung ihrer Eltern. Fünf Kinder, eine taubstumme Tante und die Großeltern blieben vorerst allein, ein Jahr später wurde die Mutter aus dem Gefängnis entlassen. Der Vater, ohne Gerichtsverfahren konterrevolutionärer Tätigkeit bezichtigt, wurde erst nach elf Jahren entlassen und 1956 rehabilitiert.
Nach Abschluss der deutschsprachigen Schule und der Musikfachschule am Konservatorium Tbilissi begann Nora Pfeffer ein Studium der Germanistik und Anglistik, das sie extern am I. Moskauer Staatlichen Pädagogischen Fremdspracheninstitut fortsetzte. Gleichzeitig unterrichtete sie die deutsche Sprache am Medizinischen Institut Tbilissi. Weil sie sich weigerte, von ihrem Vater loszusagen, wurde sie exmatrikuliert und auch aus der Musikfachschule ausgeschlossen. 1940 verlobte sie sich mit Juri Karalaschwili, dem Enkel des georgischen Katholikos. Im August 1941 wurde ihr Sohn Rewas geboren (Er verstarb 1989 mit nur 48 Jahren). „Nora Pfeffer – eine Würdigung zum 100. Geburtstag“ weiterlesen