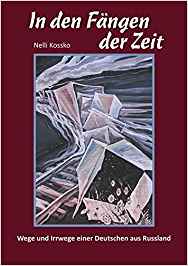In Erinnerung an Dominik Hollmann – zum 120. Geburtstag
von Nina Paulsen
Wie lange soll der Frost noch dauern? / Wann scheint die Sonne warm und mild? / Wann darf auf heimatlichen Auen / mein Volk vereint ich wieder schauen – / des Sehnsuchtstraumes süßes Bild.

In diese Zeilen aus seinem Gedichtzyklus „Meine Herzenswunde blutet…“ hat Dominik Hollmann seinen ganzen Herzensschmerz über die erniedrigende und rechtlose Lage seiner Volksgruppe gelegt. Das Problem der Gleichberechtigung der Russlanddeutschen in der Sowjetunion nach dem Zweiten Weltkrieg hat den anerkannten Prosaschriftsteller und Lyriker, Essayisten und Publizisten, Literaturwissenschaftler und Übersetzer Zeit seines Lebens beschäftigt. Er hatte nie aufgehört, den Anspruch der Russlanddeutschen auf diese Gleichberechtigung in allen Lebensbereichen einzufordern.
Dominik Hollmann kam am 12. August 1899 in Kamyschin/Wolga zur Welt. Die Mutter (an seinen Vaters konnte er sich nicht erinnern) hielt die Familie als Waschfrau, Näherin oder Magd mit Müh und Not übers Wasser. So sah sich auch Dominik ganz früh auf sich selbst gestellt. Die städtische Vierklassenschule und ein Lehrerkurs in Kamyschin, den er 1916 abschloss, war die erste Station auf dem Weg zum ersehnten Lehrerberuf. Schon mit siebzehn begann seine Lehrtätigkeit – zuerst in der deutschen Kirchenschule in seiner Heimatstadt, später in Rothammel, Erlenbach und Marienfeld. Als in Engels 1928 die Deutsche Pädagogische Hochschule eröffnet wurde, war Hollmann bereits Oberhaupt einer sechsköpfigen Familie – ein Direktstudium kam vorerst nicht in Frage. Nach zwei Jahren Fernstudium an der Moskauer Staatsuniversität, setzte er 1932-1935 seine Ausbildung an der Deutschen Pädagogischen Hochschule in Engels fort. Danach war er sechs Jahre Dozent und Dekan des Fachbereichs für deutsche Sprache und Literatur an derselben Hochschule.

Bereits während des Studiums und in der Folgezeit trat Hollmann als Autor, Übersetzer, Nachdichter und Lehrbuchverfasser hervor. Seit 1923 schrieb der junge Dorflehrer Berichte für die Zeitung „Nachrichten“, bald auch Kurzgeschichten über das Dorfleben. In den 1930er Jahren veröffentlichte er Gedichte, Kurzerzählungen und Kritiken in der deutschen Presse. Hollmann verfasste außerdem Lehrbücher der deutschen Grammatik für Schulen, stellte ein Lesebuch für Erwachsene zusammen, machte zahlreiche Übersetzungen aus dem Russischen für den Deutschen Staatsverlag und wirkte aktiv im Schriftstellerverband der ASSR der Wolgadeutschen mit. 1940 wurde er in den Schriftstellerverband der UdSSR aufgenommen. „„Meine Herzenswunde blutet …““ weiterlesen